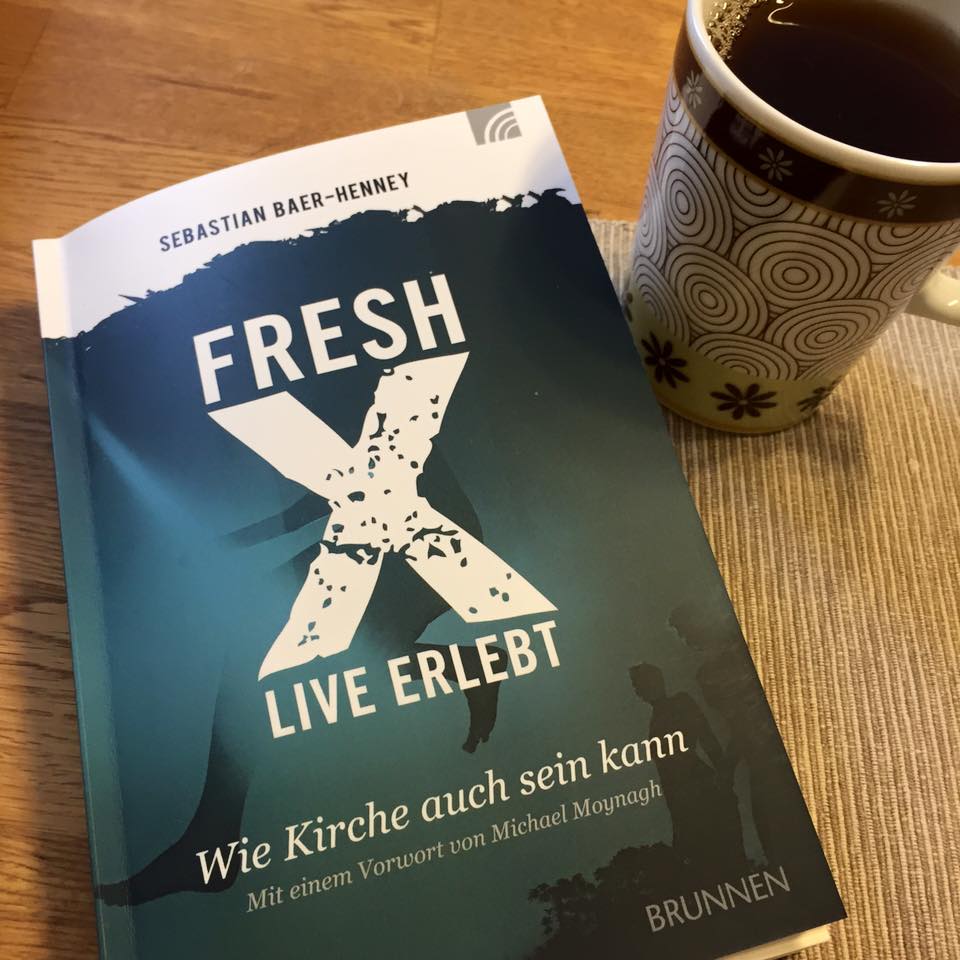Karfreitagspredigt 2019
Es gibt diese Dinge, mit denen man am liebsten nichts zu tun haben möchte. Weil sie zu nah kommen. Manche Themen, mit denen ich mich lieber nicht beschäftige. Manche Bilder, die ich nicht so schnell aus meinem Kopf bekomme, weil sie mir viel zu nah gehen. Die vom Kopf ins Herz wandern, wo selbst Tränen sie nicht rausschwemmen können. Bilder vom Tod. Schreckliche Bilder von menschlichem Leid, von Brutalität und von Unglück. Und die steigen auch auf in diesen Liedern, die selten genug gesungen und diesen Bibeltexten, die selten genug gelesen werden, weil sie nicht nur thematisieren, was ein Mensch dem anderen antut, sondern anschaulich davon erzählen.
Es gibt diese Dinge, die manchmal zu nah kommen und mit denen man am liebsten nichts zu tun haben und die man am liebsten weder sehen noch fühlen möchte. Und heute ist der Tag, an dem das alles anders ist. In dem ein paar dieser Texte gelesen und ein paar dieser Lieder gesungen werden. Heute ist der Tag, an dem Bilder hinter die Augen gemalt werden von einem, der verraten und verkauft, geschlagen und verletzt wird, mit den Farben von Qual und Schmerzen, Schuld und Angst. Was Menschen einander antun und was Menschen erleiden, das kann man hier sehen. Das ist echt und das geht nah.
Was nah geht, braucht Zeit, um verarbeitet zu werden. Sieben Wochen Zeit nehmen sich Christinnen und Christen auf der ganzen Welt, um sich an das Leiden und Sterben Jesu zu erinnern. Das, was im Grunde keine vierundzwanzig Stunden gedauert hat, bekommt Raum für sieben Wochen, das sind (Sonntage nicht eingerechnet) neunhundertsechzig Stunden! Es braucht vierzig Mal so viel Zeit, um begreifen zu können, was nicht zu fassen ist. Vierzig Mal so viel Zeit, sich dem zu nähern, das uns nicht nahe kommen soll. Und manchmal braucht es Zahlenspielereien, weil der Tod jede Ordnung ins Chaos stürzt und über jede Grammatik erhaben ist.
Das gilt auch für den Tod Jesu, von dem der Predigttext erzählt. Auch hier braucht es Zeit. Neunzehn Verse, drei- bis vierhundert Wörter, um zu erzählen, was vor dem Tod geschieht, der selbst in nur einem Vers passiert. Nur eine Handvoll Wörter. Der Tod braucht nicht viel Zeit.
Joh 19,15b-30 (NGÜ)
»Euren König soll ich kreuzigen lassen?«, fragte Pilatus. »Wir haben keinen König außer dem Kaiser!«, entgegneten die führenden Priester. 16 Da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Jesus wurde abgeführt. 17 Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus zu der so genannten Schädelstätte; auf hebräisch heißt sie Golgata. 18 Dort kreuzigte man ihn und mit ihm zwei andere, einen auf jeder Seite; Jesus hing in der Mitte.
19 Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, das die Aufschrift trug: »Jesus von Nazaret, König der Juden.« 20 Dieses Schild wurde von vielen Juden gelesen; denn der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, war ganz in der Nähe der Stadt, und die Aufschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. 21 Die führenden Priester des jüdischen Volkes erhoben Einspruch. »Es darf nicht heißen: ›König der Juden‹«, sagten sie zu Pilatus. »Schreibe: ›Dieser Mann hat behauptet: Ich bin der König der Juden.‹« 22 Pilatus erwiderte: »Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben.«
23 Die Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und teilten sie unter sich auf; sie waren zu viert. Beim Untergewand stellten sie fest, dass es von oben bis unten durchgehend gewebt war, ohne jede Naht. 24 »Das zerschneiden wir nicht«, sagten sie zueinander. »Wir lassen das Los entscheiden, wer es bekommt.« So sollte sich erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war: »Sie haben meine Kleider unter sich verteilt; um mein Gewand haben sie das Los geworfen.« Genau das taten die Soldaten. 25 Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. 26 Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter: »Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn!« 27 Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte: »Sieh, das ist jetzt deine Mutter!« Da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie.
28 Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er: »Ich habe Durst!« 29 Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Ysopstängel und hielten ihn Jesus an den Mund. 30 Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er: »Es ist vollbracht.« Dann neigte er den Kopf und starb.
Viele dieser vierhundert Wörter sind Verben. Tu-Wörter. Solche, die etwas tun und die zeigen, was passiert: Da wird gelesen und geschrieben, es wird gesprochen, befohlen, gefragt und Einspruch erhoben, gelost und geteilt, sich gekümmert und füreinander gesorgt. Und es wird gestorben. Mitten im Leben. Von der einen auf die andere Minute ist alles anders.
„Ich war nur eben schnell aus dem Zimmer gegangen“, erzählte eine Witwe. Als sie zurückkam, war ihr Mann tot. Er war ganz allein gestorben. Ganz allein und nicht einsam. Allein, selbstbestimmt. Zum letzten Mal. In den letzten Monaten hatte er alles noch geregelt, sich um alles gekümmert. Als hätte er es gewusst.
In die Traueranzeige hat sie geschrieben: Lasst mir einen Platz zwischen euch, so wie ich ihn im Leben hatte. Er hatte es sich gewünscht. Und genau so wird es für sie sein. Nie wird sie ihn vergessen und er wird weiterleben in ihrer Erinnerung. Wenn sie ihn sucht, wird sie ihn im Herzen finden. Da, wo die Erinnerungen sind. Dort wird sie dann mit ihm wieder ans Meer fahren, so wie damals, vor vielen Jahren. Der erste gemeinsame Urlaub. So viele Jahre mit diesem Menschen, der ihr alles war. Dem sie alles war.
Was wird bleiben, wenn die Erinnerungen verblassen? Wenn Stimmen leiser und Düfte schwächer werden? Was bleibt von einem Menschen, wenn die Erinnerungen nur noch Gedanken sind?
Vielleicht holt sie immer noch jedes Jahr am Hochzeitstag die Kiste mit den Bildern aus dem Schrank. Zündet an seinem Geburtstag eine Kerze für ihn an. Und vielleicht pflanzt sie im Garten endlich die Sonnenblumen, die er schon immer haben wollte.
Vielleicht machen wir das heute so ähnlich. Hören zu, wie das damals war. Sehen die Bilder an. Die, über die wir lachen und die, die zum Heulen sind oder zum Fürchten. Wir erinnern uns. Lassen die Erinnerungen lebendig werden, gehen den ganzen Weg noch einmal mit, Schritt für Schritt. Erinnerung für Erinnerung. Das tut weh und das tut gut. Wie war das, mit Jesus? Wir sehen den Jordan und zwei Menschen mittendrin und hören Worte wie ein Sommerregen von oben: Das ist mein geliebter Sohn. Hören alle sich des Lebens freuen, denen Jesus es wiedergegeben hat. Stehen wieder mitten unter denen, die Palmwedel schwenken und Hosianna schreien, sitzen im Garten neben den schlafenden Jüngern, hören die Schwerter klappern, als die Soldaten anrücken, die Frage des Hohepriesters durch die Hallen poltern: Bist du der Christus, der Sohn Gottes?, hören den Chor der Männer und Frauen hoch zum Balkon: Lass ihn kreuzigen!, und die Schläge auf einen Körper, der sich nicht wehrt. Ein Hammer, der Nägel in Holz schlägt. Rangelnde Soldaten, die an Kleidungsstücken zerren. Ihre Füße, die über den Sand scharren. Und einer, der seine letzten Worte spricht: Es ist vollbracht. Und die Welt steht still für einen Augenblick. Einen Moment nur ist alles ruhig. Noch nicht mal ein Flüstern. Totenstille. Und das Leben geht danach trotzdem weiter. Das Leben geht weiter. Unterm Kreuz.
Unterm Kreuz ist der Ort, an dem die Verzweifelten neben den Gefassten stehen, hier treffen sich das ganze Elend des Menschseins, das Ausgeliefertsein an das, was Leben zerstört und die Hoffnung darauf, dass das nicht alles gewesen sein kann. Unterm Kreuz werden Menschen befreit. Befreit von dem lähmenden Blick in die Vergangenheit, befreit vom beängstigenden Blick in eine unsichere Zukunft. Unterm Kreuz werden Menschen aus der Totenstarre befreit. Sie werden frei, den Tod nicht zu fürchten und das Leben zu lieben. Weil Gott Leben schenkt und Leben liebt und er dir deine Schuld vergibt und weil er sich an deine Seite stellt.
Unters Kreuz, wo wir jetzt stehen. Und die Fragen kommen.
Was war? Was wird sein? Was ist? Das ist nicht mehr. Denn Gott nimmt unsre Zeit in seine Hände. Unterm Kreuz verschwinden die Grenzen zwischen Vergangenheit und Zukunft. Hier wird der Raum weit, in den er uns stellt und der Boden fest, auf dem wir stehen.
Unterm Kreuz.
Heute ist der Tag, an dem wir etwas länger als sonst unterm Kreuz stehen.
Jetzt ist die Zeit, in der wir aushalten, womit wir sonst am liebsten nichts zu tun haben wollen.
Drei Tage lang.
Gefühlt: Eine Ewigkeit.
Amen.